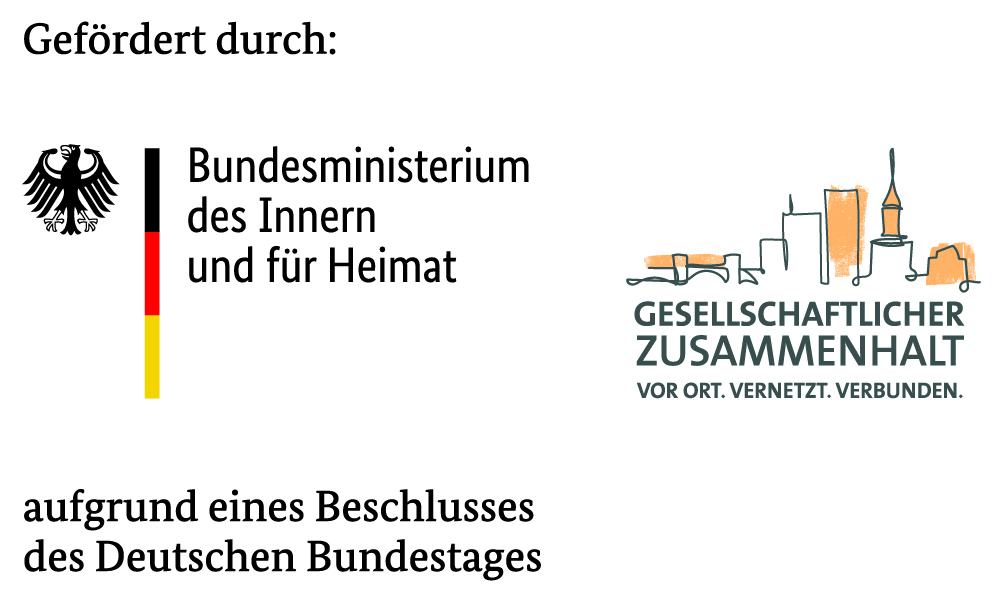Veröffentlicht am 11.10.2023
Dilek Tepeli: Hanıms Rezept | „Uff, Dilek, kafam ağrıyor, mir reichts! Du stellst immer so viele Fragen!“
Dilek Tepeli war eine der Teilnehmerinnen des Workshops Kreatives Schreiben und biografische Erinnerungsarbeit, den wir im späten Frühjahr und frühen Sommer 2022 unter der Leitung von Judith Baumgärtner im Kunstmuseum Bochum organisiert haben. Ziel dieses Workshops war es, einen Raum zum Nachdenken und Experimentieren über den Dialog zwischen den Generationen und die Erinnerungsarbeit in der Familie zu schaffen.
(Der Austausch mit Dilek Tepeli hat das Projekt Stadt der Vielen auch in Universitätsseminare geführt, was noch an anderer Stelle Erwähnung finden wird.)
Hanıms Rezept
von Dilek Tepeli
„Die Mutterliebe ist (..) die bedingungslose Bejahung des Lebens und der Bedürfnisse des Kindes. Aber hier ist noch etwas Wichtiges hinzuzufügen. Die Bejahung des Lebens des Kindes hat zwei Aspekte: der eine besteht in der Fürsorge und dem Verantwortungsgefühl, die zur Erhaltung und Entfaltung des Lebens des Kindes unbedingt notwendig sind. Der andere Aspekt geht über die bloße Lebenserhaltung hinaus. Es ist die Haltung, die dem Kind jene Liebe zum Leben vermittelt, die ihm das Gefühl gibt: Es ist gut zu leben, (..), es ist gut auf der Welt zu sein!“ (Fromm 2019, S.82f.)
Dieser Text erzählt von der Beziehung und Bindung zwischen mir und meiner Mutter, von der unentwegten Sehnsucht nach Verbundenheit zu ihr. Das Bild, das ich Euch hier von ihr zeichne, ist aus meiner subjektiven Perspektive – also der Sichtweise ihrer jüngsten Tochter– geschrieben. Es baut auf meinen eigenen Erlebnissen, Phantasien und Deutungen über meine Mutter auf. Ich konnte immer nur diesen kleinen, begrenzten Ausschnitt ihrer Identität wahrnehmen, alles andere blieb mir fremd, unvertraut und unbekannt. Vieles von der Persönlichkeit meiner Mutter blieb also im umschwiegen Verborgenen, auf der Hinterbühne, wie dies der Soziologe Erving Goffman metaphorisch treffend nannte. Sie erscheint euch innerhalb dieser Erzählung hier also in der Rolle als Mutter – eine Rolle, die sie schon sehr lange innehat, nämlich, seit sie fünfzehn Jahre alt ist. Meine Mutter trägt auch einen Namen. Sie heißt Hanım. „Dame“ oder „Fräulein“ ist die Übersetzung ins Deutsche. Es heißt weiter, der Name bezeichne eine weibliche Person, die alle Vorzüge der Weiblichkeit in sich trage. Ich kann der Bedeutung nur zustimmen, so wie ich Hanım, meine wunderschöne Mutter, seit meiner Geburt erlebt habe. Sie hat nicht nur mich auf die Welt gebracht, sondern noch fünf weitere, einzigartige Kinder – sowas wie Einsamkeit, Langeweile oder Monotonie gab es Zuhause also glücklicherweise nicht.
Doch was bedeutet Mutterschaft bzw. die Liebe der Mutter ihren Kindern gegenüber eigentlich? Dazu zitiere ich den Psychoanalytiker Erich Fromm. Er sagt, die Mutterliebe bestehe in der bedingungslosen Liebe und sei die höchste Ausdrucksform des Altruismus: „Wegen dieses altruistischen, selbstlosen Charakters“, schrieb Fromm, „gilt die Mutterliebe als die höchste Art der Liebe und als heiligste aller emotionalen Bindungen“ (Fromm 2019, S.84). Fromm geht in seinen Schriften über die Liebe von spätmodernen, kapitalistischen Gesellschaften aus. Inwiefern dies universale Gültigkeit hat, mag man infrage stellen, auch wie die Frage danach, inwiefern diese psychoanalytische Deutung die Rolle der Mutter überbetont. Denn auch die väterliche Liebe dem kleinen Kinde gegenüber ist eine tiefe, altruistische Liebe. Die Mutterliebe ist aber das, wovon diese Zeilen handeln sollen. Meine Mutter hat mich trotz großer Entbehrungen mit einem Leben, materiellen sowie immateriellen Gaben der Fürsorglichkeit, Liebe und Zuneigung beschenkt. Auch wenn Hanım als Mutter besonders für die Älteren in unserer Geschwisterfolge sehr fordernd und auch sehr einnehmend sein kann, so erlebte ich ihre Wärme uns Kindern und auch meinen Freund:innen gegenüber häufig mit dem Gefühl der Geborgenheit. So kochte und backte sie z.B. ganz besondere Dinge für uns, von denen sie wusste, dass wir sie liebten. Das ist bis heute so geblieben.
Ich erinnere mich noch sehr genau an eine Szene mit ihr, in der wir einander auf einem Klassenausflug zu einem Museum verloren hatten. Sie hatte mich zu diesem begleitet und mir den Wunsch erfüllt, mitzukommen – und das, obwohl sie nicht perfekt Deutsch sprach. Mama, aus heutiger Sicht bewundere ich Dich für diese Größe und Stärke, die Du in Dir trägst. Ich bewundere den Mut, den Du aufbrachtest, Dich für Deine Kinder in die Welt der Fremdheit und merkwürdig klingenden Laute einer anderen Sprache und Kultur zu begeben. Ich erinnere mich besonders lebhaft an unsere Wiedervereinigung. Die Mutter meiner Schulkameradin Kathi fand mich durch Zufall ganz allein, aufgelöst und völlig verängstigt. Ich suchte nach Dir, Mama, weil ich mich ohne dich in der unbekannten Fremde so verloren fühlte. Wie stark das Gefühl von Angst, sie verloren zu haben, in mir tobte, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich fühlte einen heftigen Schmerz der Trennung. Kathis Mama beruhigte mich mit ihrer lieben Art und brachte mich zu meiner Mama. Schon von Weitem sah ich sie auf mich zukommen. Als sie näherkam, sah ich in ihr sorgevolles Gesicht. Trennungsängste zogen tiefe Linien in ihrer Miene. Ich spürte auch ihren Schmerz und die Angst, mich verloren zu haben. Als mich Hanım sah, ihre kleine, nach ihr suchende Tochter, strahlte sie mich mit ihren hellbraunen, klugen Augen an. Sie nahm mich voller Erleichterung so fest in den Arm, als würde sie mich nie mehr loslassen wollen. Ich fühlte ihren warmen, weichen Körper und ein tiefes Gefühl von Geborgenheit breitete sich in mir aus. „Dilek, kızım! Da bist du ja!“ „Mama. Ich bin so glücklich, dass Du wieder da bist“, dachte ich. Unser temporäres Getrenntsein, dieses krisenhafte Ereignis, schärfte mein Bewusstsein und mein Herz für die unzertrennliche, tiefe Verbundenheit zu ihr. Immer wenn ich Angst hatte oder mich allein fühlte, warst Du da. Wenn ich nachts von Albträumen geplagt, weinend erwachte, warst Du da. Einmal legtest du mir einen kleinen, heiligen Stock, aus einem deiner heiligen alevitischen Wälder in den ostanatolischen Bergen, unter mein Kissen. Dann erklärtest du mir, er würde mich vor den beängstigenden Träumen beschützen, in denen ich dich und Papa und meine so geliebten Geschwister Zinnet, Hüseyin, Gülnur, Dilara und den kleinen Ali häufig verlor und allein zurückblieb. Ich glaubte an die Macht dieses Waldstücks unter meinem Kissen, nur weil diese Geste von dir kam. Dann spürte ich, wie du mich liebtest und wie sehr ich mich auf dich verlassen konnte – auch wenn du manchmal sauer auf mich sein konntest.
Diese Erinnerung hat in meinem Gedächtnis und meiner Gefühlswelt tiefe Verankerung gefunden. Ich möchte euch aber kein verklärtes, einseitiges Bild vermitteln. Die Beziehung von mir und meinen Geschwistern zu unserer Mutter ist ambivalent, konflikthaft und bisweilen schwierig (gewesen). Wie so oft in (post-)migrantischen Eltern-Kind-Beziehungen übernahmen dabei vor allem meine älteren Geschwister die Rolle einer Mutter und eines Vaters. Unsere geliebte „anne“ (Mama) hat sich mithilfe ihrer Durchsetzungskraft den liebevollen Ehrentitel „kleine Imperatorin“ verdient. Da die kleine Imperatorin aber weder die kurdische oder türkische noch die deutsche Schriftsprache erlernen konnte, schreibe ich heute als „Erbin“ ihrer Geschichte. Ich vertrete sie als ihre Geschichtsschreiberin und kommentiere das Geschehene aus der involvierten, aber auch beobachtenden Perspektive der Tochtergeneration.
Diese Sehnsucht danach meine Mutter als eigenständige Person, mit einer unverwechselbaren Geschichte, besser zu verstehen, ergriff mich besonders als Heranwachsende. Wer war diese faszinierende, starke und geheimnisvolle Frau eigentlich, außer meiner Mutter, noch alles? Ihr Leben und Aufwachsen im ostanatolischen Dorf Altınpınarköy war in jeder Hinsicht fremd für mich. Ich suchte fast schon wie eine Historikerin oder eine Ethnologin nach Antworten auf Fragen an eine radikal fremde Zeit und Kultur, aus der meine Eltern stammten. Ich fragte mich, was sie wohl vor meiner Zeit für ein Leben geführt hatte? Wie sah sie aus, welche Art von Kleidung trug sie, als sie so alt war wie ich? Wie erlebte und fühlte sie ihren Alltag als junges Mädchen? Und wie konnte diese so anmutige, kluge Frau, die nur gebrochen Deutsch sprach, all die Herausforderungen des Alltags in der Fremde überstehen, ohne daran zu zerbrechen? Wie konnte sie all dem Leid und den traumatischen Erlebnissen, die das ungerechte, gewaltvolle Patriarchat nicht nur meiner Mutter, sondern vielen jungen Frauen, zumutete, so widerständig, eigensinnig und voller Entschlossenheit begegnen?
„Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück“, dichtet die Lyrikerin Mascha Kaléko in ihrem Gedicht „Rezept“. Die Lyrikerin hat Recht, es kam doch ohnehin von allein auf uns zu, in verschiedenster Gestalt. Es ist eines dieser ungeschriebenen Rezepte meiner Mutter, die sie mir mitgab. Meine Mutter erinnert mich wieder und wieder daran, dass wir das (Er)leid(en) und die Melancholie der Abgetrenntheit und Vergänglichkeit als einen festen Bestandteil unseres Lebens akzeptieren müssen. Auch sie sagt, suche nicht nach leidvollen Erfahrungen. „Dreh dich nicht allzu oft um. Schreite im hier und jetzt weiter und blicke nach vorn. Nur von hier aus kannst du wirksam handeln“, sagt sie zu mir in einem unserer vielen Gespräche Diese Lebensklugheit und Weisheit meiner Mutter bewundere ich. Meine Mutter ist trotz all den schrecklichen Widerfahrnissen nie passiv, ohnmächtig oder machtlos geblieben. Hanıms Widerstand und Eigensinnigkeit habe ich ebenfalls geerbt. Ihre Art, auf die Welt zu blicken und mit Unrecht umzugehen, erfassten mich unmerklich. Wir schauen nicht weg! Wenn jemand Hilfe braucht, sind wir da. Wir geben und wir halten zusammen. Das sind die ungeschriebenen, unausgesprochenen, gelebten Regeln, die du mir mitgabst und die mich zutiefst prägten. Hanım war eines der wichtigsten feministischen Vorbilder für mich, ohne jemals den politischen Kampfbegriff Feminismus gehört oder gebraucht zu haben. Weder Hanım noch andere Frauen waren den hegemonialen Machtverhältnissen des ostanatolischen Patriarchats bloß ausgeliefert. Sie und die anderen, starken und widerständigen Frauen brachten sehr viel Mut, Klugheit, Zusammenhalt und Kraft auf, um sich gegen die Fremdzwänge des Patriarchats und seiner Verteter:innen, entgegenzustellen.
Dass meine Mutter häufig schwieg, wenn ich sie nach ihrer Biographie befragte, begriff ich erst durch das Interview, das ich im Rahmen dieses Projekts mit ihr durchführte. Ich verstand erst dann, dass ihr Schweigen sie und auch mich davor beschützen sollte, all das erneut zu durchleben. Als Soziologin suchte ich eine Erklärung dafür und borge sie mir von Fritz Schütze, einem Soziologen, dessen Perspektiven mich sehr faszinieren. Er meint, dass wir Menschen im Erzählen durch die von uns erlebten und erlittenen Erfahrungsströme wieder hindurchfließen und so unsere vergangenen Erlebnisse erneut durchlebten. Dadurch würden alte Erfahrungen, auch die schmerzhaften, gefühlsmäßig wieder in der Gegenwart präsent. So muss ich aus heutiger Perspektive einsehen, dass das Nichtgelingen darin, meine Mutter mit meinen penetranten Nachfragen zum Erzählen zu bringen, einen Sinn und Zweck hatte. Sie beschützte uns beide mit ihrem Schweigen. Ich erinnere, wie unsere kurzweiligen Gespräche häufig abrupt endeten. Fragen wie „Mama, erzähl doch mal, wie war das als ihr nach Deutschland kamt, wieso seid ihr überhaupt hergekommen?“ wurden oftmals mit einem genervten Laut abgewehrt: „Uff, Dilek, kafam ağrıyor, mir reichts! Du stellst immer so viele Fragen!“ Aus meiner Sicht war doch keine Frage zu viel oder unnötig – wie sollte man denn die Welt oder sich Selbst verstehen, wenn man keine Fragen stellte? Meine Mutter, die Erhabene, die Würdevolle. Heute tut es mir manchmal leid, dass ich dich mit meinen ständigen Nachfragen so bedrängte. So war meine liebenswerte Mutter neben all den anderen Anforderungen der alltäglichen Lebens- und Existenzbewältigung einer türkeistämmigen Migrantin in Deutschland also obendrein noch dem permanenten Druck ihrer aufgeweckten, impulsiven und ahnungslosen Kinder ausgesetzt, Geschichten und Antworten abliefern zu müssen. In unserem letzten Gespräch mit mir sagtest du dann entschuldigend: „Du warst doch noch klein, wie solltest du das alles verstehen?“ Mittlerweile sind einige Jahre vergangen. Ich blieb eine hartnäckig fragende Tochter, wie dieser Text wohl beweist. Doch zeigt er ebenso ein unverändertes Beziehungsmuster zwischen uns beiden, das ich seit meiner Kindheit kenne: Aus Liebe zu mir ließ sie sich auf das Projekt „Stadt der Vielen“ ein. Doch blickt mein erwachsenes Ich-Bewusstsein mit anderen Augen auf die damals Mittdreißigerin – diese bin ich heute selbst. Ich glaube ja, dass das neugierige Kind damals all diese Fragen gar nicht so sehr aus Wissbegierde stellte. Das Kind versuchte die empfundene Distanz zu dieser bewundernswerten, geliebten Frau zu verringern und wollte ihr nah sein. Vielleicht kann ich es so ausdrücken: Die Versuche, meiner Mutter ein paar Selbsterzählungen zu entlocken, sollten narrative Brücken und Verbindungen in ein mir fremdes Leben bauen, um das Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit zu ihr zu stillen. Die erneute Auseinandersetzung mit ihrer Lebensbiographie und die Möglichkeit mich aus der heutigen Position in sie einfühlen zu können, erfüllten dieses Bedürfnis nach Verbundenheit, ohne dass ich sie weiter zum Reden und damit Wiedererleben traumatischer Erfahrungen nötigen musste.
Literatur:
Fromm, Erich (2019 [1956]). Die Kunst des Liebens. München: dtv Verlag.
Dank:
Ich bedanke mich herzlich für die hilfreichen Korrekturen und Anmerkungen bei Patrick Ritter, Eduard Müller und Hannah Gajsar.
___
Text: Dilek Tepeli
Fotos: Ana Maria Sales Prado